Abstrakt
Ein Polytrauma tritt auf, wenn eine Person häufig, aber nicht immer, infolge von Explosionsereignissen Verletzungen an mehreren Körperteilen und Organsystemen erleidet. TBI tritt häufig bei Polytrauma in Kombination mit anderen behindernden Zuständen auf, wie Amputation, Verbrennungen, Rückenmarksverletzung, Hör- und Sehschäden, Rückenmarksverletzung (SCI), posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und andere Erkrankungen. Aufgrund der Schwere und Komplexität ihrer Verletzungen erfordern Veteranen und Servicemitglieder mit Polytrauma ein hohes Maß an Integration und Koordination der klinischen Versorgung und anderer Unterstützungsdienste
Bedeutende Fortschritte bei Schutzausrüstung und medizinischer Technologie haben die Überlebensraten von US-Soldaten erhöht, die bei den jüngsten Kampfeinsätzen schwere Mehrfachverletzungen oder Polytrauma erlitten haben. VA hat früh erkannt, wie wichtig es ist, koordinierte und umfassende Rehabilitationsdienste bereitzustellen, um die Genesung nach einem Polytrauma zu unterstützen, und entwickelte ein spezialisiertes Polytrauma-Versorgungssystem. Das Markenzeichen der Polytrauma-Versorgung ist ein patientenzentrierter, interdisziplinärer Ansatz, der mit dem Verletzten und seiner Familie zusammenarbeitet, um alle Aspekte der Verletzung anzugehen, die sich auf das Leben der Person auswirken.
Der hämorrhagische Schock ist eine der Haupttodesursachen bei Patienten mit schwerem Polytrauma. Um die Überlebensraten zu erhöhen, wurde eine kombinierte Behandlungsstrategie namens Damage Control entwickelt.
Ziel dieses Artikels ist es, das aktuelle Konzept der Damage Control Resuscitation und seiner drei Behandlungsebenen zu analysieren, die beste Transfusionsstrategie zu beschreiben und die akute Koagulopathie des traumatischen Patienten als Einheit zu betrachten. Auch die möglichen Veränderungen dieser Therapiestrategie in den kommenden Jahren werden beschrieben.
Einführung
Die häufigsten Todesursachen bei Polytraumapatienten sind Blutungen und traumatische Hirnverletzungen (TBI). Polytrauma hat in den letzten zehn Jahren aufgrund seiner globalen Bedeutung als eine der Hauptursachen für vermeidbare Todesfälle erhebliches Interesse auf sich gezogen.1 In Europa sind Verkehrsunfälle eine der Hauptursachen für Polytrauma. Laut dem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichten Global Status Report on Road Safety 2018 sind Verkehrsunfälle jedes Jahr für 1,35 Millionen Todesfälle verantwortlich. Sie sind bereits die achthäufigste Todesursache für alle Altersgruppen, die erste bei jungen Menschen und werden im Jahr 2030 die dritthäufigste Ursache für Behinderungen sein.2
Die Entwicklung von Polytrauma-Patienten ist hochdynamisch und zwingt Kliniker, ihre Reaktion auf verschiedene Behandlungen, sowohl chirurgische als auch medizinische, die gleichzeitig durchgeführt werden, ständig neu zu bewerten. Der Begriff Schadensbegrenzung wurde erstmals in der US-Marine verwendet, um die Techniken zu definieren, die erforderlich sind, um ein beschädigtes Schiff zu retten, indem es zur endgültigen Reparatur in einen sicheren Hafen gebracht wird. Chirurgische Techniken, die als Damage Control Surgery (DCS) bekannt sind, wurden erstmals in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts beschrieben und anschließend erweitert.3 Damage Control Resuscitation (DCR) wurde später im militärischen Umfeld als nicht-chirurgisches Protokoll zur Blutstillung entwickelt und den physiologischen Zustand zu korrigieren oder wiederherzustellen.4 DCR wurde schnell im zivilen Umfeld übernommen und mit DCS kombiniert, um Patienten mit schwerem Polytrauma zu behandeln. Die Wirksamkeit der DCR hängt von der Geschwindigkeit ab, mit der eine Blutung diagnostiziert und gestoppt wird. Daher erhöht der zeitnahe Einsatz dieser Strategie im präklinischen Umfeld, bekannt als Remote Damage Control Resuscitation (RDCR), die Überlebenschancen.

Reanimation zur Schadensbegrenzung
Ziel der DCR ist es, Blutungen schnell zu kontrollieren und Koagulopathien vorzubeugen, indem die Sauerstofftransportkapazität und Gewebedurchblutung aufrechterhalten werden. Um dies zu erreichen, werden 3 Behandlungsebenen gleichzeitig verabreicht: (1) hämodynamische Reanimation mittels restriktiver Flüssigkeitstherapie, permissiver Hypotonie und massiver Transfusion; (2) metabolische Wiederbelebung, indem der Patient vor Hypothermie, Azidose und Hypokalzämie geschützt wird, und (3) hämostatische Wiederbelebung, um sie zu verhindern oder rückgängig zu machen.
Schlussfolgerungen
DCR ist eine strukturierte, dynamische, anpassungsfähige Strategie, die auf hämodynamischer, hämostatischer und metabolischer Reanimation basiert und bei Patienten mit schwerem Polytrauma in jeder Umgebung (Präklinik, Notaufnahme, Embolisationsraum, Operationssaal oder reanimationskritischer Raum) eingesetzt werden kann. Die Ziele der DCR sind eine schnelle Kontrolle der Blutung und die Verhinderung einer Gerinnungsstörung durch frühzeitige Transfusion und minimalen Flüssigkeitsverbrauch. Permissive Hypotonie ist derzeit eines der Hauptmerkmale von DCR, aber die Blutdruckwerte sollten es sein




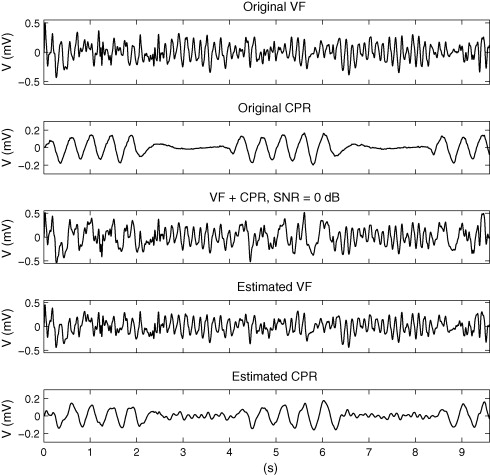 Datensammlung
Datensammlung




